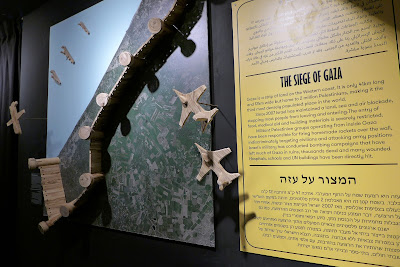Das
Gebiet rund um die palästinensische Sperrmauer von Betlehem ist
hässlich und unattraktiv.
Mit dem „Walled Off Hotel“ will Street Art Künstler Banksy Leuten diesen Ort näher bringen.
Mit dem „Walled Off Hotel“ will Street Art Künstler Banksy Leuten diesen Ort näher bringen.
Aus der Ferne wirkt es zunächst wie ein Grandhotel. Von Nahem sieht man jedoch, dass die altmodische Fassade nur aufgemalt ist. Ein palästinensischer Portier in Frack und Zylinder öffnet die Tür. Beim Betreten der Pianobar, die als Lobby dient, wähnt man sich in einem britischen Gentleman-Club zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zwischen weichen Polstern und Trophäen aus den Kolonien kann man hier bei Klaviermusik englischen Tee in feinstem Chinaporzellan genießen und dabei den Blick aus dem Fenster schweifen lassen – und glotzt direkt auf Beton. Mit der „hässlichsten Aussicht der Welt“ wirbt das „Walled Off (zu deutsch: eingemauerte) Hotel“ für seine insgesamt zehn Zimmer, deren Fenster keinen anderen Ausblick als den auf die Grenzmauer freigeben.
Das
kürzlich eröffnete Kunstprojekt des britischen Streetart Aktivisten
Banksy steht in Bethlehem, Palästina, direkt neben einer acht Meter
hohen Grenzmauer aus Beton. Errichtet mit der Begründung, dass sie
vor Terrorismus schützt, verstößt die seit 2002 im Bau
befindliche, fast 800 Kilometer lange Sperranlage zwischen dem
Westjordanland und Israel gegen internationales Recht. Wer als
Europäer die streng bewachten Checkpoints passiert, ist deutlich
privilegiert, anders als die Bevölkerung Palästinas: von hier darf
nur ausreisen, wer eine ausdrückliche Sondergenehmigung besitzt.
 Banksy,
Streetart Star mit geheimer Identität, hat bereits vor zwölf Jahren
begonnen, in Bethlehem politische Schablonengraffitis anzubringen.
Diese haben Heerscharen von Fans angezogen: angeblich wird der
biblische Ort schon von mehr „Banksy“-Touristen als von
„Jesus“-Touristen frequentiert.
Banksy,
Streetart Star mit geheimer Identität, hat bereits vor zwölf Jahren
begonnen, in Bethlehem politische Schablonengraffitis anzubringen.
Diese haben Heerscharen von Fans angezogen: angeblich wird der
biblische Ort schon von mehr „Banksy“-Touristen als von
„Jesus“-Touristen frequentiert. Doch ob Streetart – wie von vielen Palästinensern erhofft – der restlichen Welt die prekäre Lage vor Ort wirklich nahe bringen kann, ist umstritten. Kritiker befürchten eine Beschönigung der völkerrechtlich inakzeptablen Grenzmauer oder deren falsche Darstellung in den Medien, die zur „Normalisierung“ der israelischen Besatzung Palästinas beitrüge.
Dass
sich Banksy dieses Widerspruchs bewusst ist, verdeutlicht Jamil
Khader, Anglistikprofessor und Studiendekan an der Bethlehem
University, anhand einer Anekdote. Der in Haifa geborene Araber, der
lange in den Vereinigten Staaten lebte, forscht zu Banksy's Werken in
Palästina.
 "Verschiedenen
Quellen zufolge hat Banksy tatsächlich einmal selbst Folgendes
erzählt: eines Tages, als er gerade die Mauer bemalte, kam ein
älterer, Palästinensischer Mann vorbei und fragte: Was machst du
da? Und Banksy antwortete: Ich male auf die Mauer. Woraufhin der alte Mann
ihn ansah und sagte: Tu das nicht. Die Mauer ist häßlich. Mach sie
nicht schön. Geh heim.
"Verschiedenen
Quellen zufolge hat Banksy tatsächlich einmal selbst Folgendes
erzählt: eines Tages, als er gerade die Mauer bemalte, kam ein
älterer, Palästinensischer Mann vorbei und fragte: Was machst du
da? Und Banksy antwortete: Ich male auf die Mauer. Woraufhin der alte Mann
ihn ansah und sagte: Tu das nicht. Die Mauer ist häßlich. Mach sie
nicht schön. Geh heim.
Was
die geopolitischen Umstände in Palästina betrifft, bin ich selbst
der Meinung, dass viele Leute auf der Welt die Besatzung
“normalisieren”. Die Besatzung wurde verharmlost und
verschwiegen. Tatsächlich macht Banksy gerade dadurch, dass er auf
diese Mauer malt oder indem er direkt daneben dieses neue
Installationshotel eröffnet, auf diese Mauer und auf das
Apartheidregime aufmerksam. Und ich denke, genau darin liegt die
Stärke seiner Arbeit.”
Ein
häufiges Stilmittel in Banksy's Werken ist die stark überzeichnete
oder krass untertriebene Darstellung bestehender Verhältnisse, die
deren Drastik herausstellen soll. Im Falle eines Banksy Graffitos
über einem Hotelbett sorgt diese Machart für Kontroversen.
Das Bild
von einer Kissenschlacht zwischen einem israelischen Soldaten und
einem palästinen-sischen Bürger wurde dafür kritisiert, dass es von
zwei Gegenübern auf Augenhöhe ausgeht. Der von Anfang an
asymmetrische Nahostkonflikt jedoch habe noch nie auf Augenhöhe
stattgefunden.
Jamil
Khader hält diesen Vorwurf für unreflektiert:
"Wenn man bei Kunst die Dinge, die man sieht, wörtlich nimmt, ohne ihren
Kontext oder ihre Symbolik zu berücksichtigen, dann verpasst man
ihre wahre Bedeutung. Was man in diesem Gemälde sieht, entspricht
nicht eins zu eins Banksys Sichtweise. Vielmehr kritisiert er oder
verspottet oder parodiert sogar die Art und Weise, wie heutzutage im
öffentlichen Diskurs, in den Massenmedien und von westlichen
Regierungen mit dem palästinensischen Freiheitskampf umgegangen
wird. Die Leute neigen dazu, zu glauben, dass Palästinenser und
Israelis in dem Konflikt gleichberechtigte Partner sind. Dabei kann
Israel, welches die sechststärkste Militärmacht der Welt ist und
die zehntstärkste Wirtschaft der Welt besitzt, niemals mit der
Wirtschaft Palästinas oder der Sicherheitslage für die
Palästinenser verglichen werden. Was Banksy uns zeigt, ist, dass der
Palästineser gerade deshalb an der Kissenschlacht teilnimmt, weil er
eigentlich gar keine Wahl hat. Die Palästinenser sind immer die
Unterlegenen."
 Weitgehend
auf Ironie verzichtet hingegen das kleine Museum im Erdgeschoss des
Hotels.
Weitgehend
auf Ironie verzichtet hingegen das kleine Museum im Erdgeschoss des
Hotels. Es präsentiert zunächst nüchtern und faktisch die geopolitische Geschichte Palästinas seit seiner Kolonialisierung.
Weniger nüchtern und durchaus nicht subtil in ihrer Botschaft erscheinen dagegen weitere Exponate, die Mittel der militärischen Unterdrückung durch Israel darstellen.
An eine Geisterbahn erinnert
schließlich die lebensgroße Puppe des englischen Lord Balfour am
Ende des Rundgangs, die auf Knopfdruck wieder und wieder den Vertrag
von 1917 unterzeichnet, der der zionistischen Bewegung einen
jüdischen Staat in Palästina versprach.
"I'm ashamed to be British",, äußert sich eine Hotelbesucherin. Vor
kurzem hat sie in London an einer Demonstration teilgenommen: Im Zuge
einer aktuellen Debatte um die „Balfour Declaration“ forderten
britische Bürger die Regierung auf, das hundertjährige Jubiläum
nicht mit Nationalstolz, sondern
mit einer öffentlichen Entschuldigung für die Fehler der englischen
Kolonialpolitik zu begehen.
Jamil
Khader betont, dass Banksy sich als Brite dem Nahostkonflikt nicht
als „Jemand von außen“ nähert:
"Das
erste, was Banksy einem deutlich machen will, wenn man das Hotel
betritt, ist, dass man sich in einem Gentleman-Club befindet ̶
in
einem kolonialen Verein, der hier ist, weil Großbritannien hier war.
Dass die englische Regierung und das englische Volk eine
Verantwortung haben, wenn es um Palästina geht. Er macht auf ein
großes Problem in der englischen Geschichte aufmerksam. Vor allem
gerade jetzt, wo führende, englische Politiker wie die
Premierministerin Theresa May und Andere von der Bevölkerung
verlangen, stolz auf die Balfour Deklaration zu sein. Wie kann man
denn stolz auf ein Schriftstück sein, das der Weltbevölkerung so
viel Leid verursachte, allen voran den Palästinensern?"
Neben
den zahlreichen Installationen und Gemälden von Banksy sind im Hotel
auch weitere Künstler vertreten, wie Sami
Musa und Dominique Petrin, die individuelle Hotelzimmer gestalteten.
Eine großräumige, durch die Lobby erreichbare Galerie ist
ausschließlich Werken palästinen-sischer Künstler vorbehalten,
darunter Berühmtheiten wie Sliman Mansour und Khaled Hourani.
 Die
Website des Walled Off weist auf die Uneigennützigkeit des
Etablissements hin: sämtliche Gewinneinnahmen sollen in lokale
Projekte fließen. Auch die Aussage des Hotelmanagers bestätigt,
dass hier lokale Arbeitskräfte gefördert werden: Die rund fünfzig,
auf sympathische Weise unsicheren, palästinensischen
Hotelangestellten, die die Essensbestellung verwechseln und beim
Kassieren versehentlich zu wenig verlangen, bräuchten eben noch
etwas Zeit, um in den neuen Job hineinzuwachsen.
Die
Website des Walled Off weist auf die Uneigennützigkeit des
Etablissements hin: sämtliche Gewinneinnahmen sollen in lokale
Projekte fließen. Auch die Aussage des Hotelmanagers bestätigt,
dass hier lokale Arbeitskräfte gefördert werden: Die rund fünfzig,
auf sympathische Weise unsicheren, palästinensischen
Hotelangestellten, die die Essensbestellung verwechseln und beim
Kassieren versehentlich zu wenig verlangen, bräuchten eben noch
etwas Zeit, um in den neuen Job hineinzuwachsen.
In
Palästina ist die Arbeitslosigkeit hoch. Die Wirtschaft leidet unter
dem Konflikt und der Besatzung. Jamil Khader sieht in Banksys
Bemühungen auch ein Statement zur wirtschaftlichen Lage Palästinas:
 "Sein
wichtigster Ansatz hierbei ist für mich das, was er in punkto
Konfliktlösung mitteilt. Dass es keine wirkliche politische Lösung
geben kann, solange es keine wirtschaftliche Lösung der Problematik
gibt. Erst, wenn die Palästinenser wirtschaftlich unabhängig sind,
kann tatsächlich über eine realistische, politische Lösung
gesprochen werden. Aus diesem Dilemma wird es so lange keinen Ausweg
geben, bis es einen unabhängigen, palästinensischen Staat gibt.
Erst ein solcher Staat wird in der Lage sein, mit den Israelis und
der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten."
"Sein
wichtigster Ansatz hierbei ist für mich das, was er in punkto
Konfliktlösung mitteilt. Dass es keine wirkliche politische Lösung
geben kann, solange es keine wirtschaftliche Lösung der Problematik
gibt. Erst, wenn die Palästinenser wirtschaftlich unabhängig sind,
kann tatsächlich über eine realistische, politische Lösung
gesprochen werden. Aus diesem Dilemma wird es so lange keinen Ausweg
geben, bis es einen unabhängigen, palästinensischen Staat gibt.
Erst ein solcher Staat wird in der Lage sein, mit den Israelis und
der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten."
Die
widersprüchlichen Annehmlichkeiten des Hotels hinterlassen Wirkung.
Insgeheim schämt man sich für die eigene, unfreiwillige Dekadenz,
möchte sich von den freundlichen Palästinensern nicht einfach nur
bedienen lassen, um anschließend tatenlos wieder abzureisen. Ob
allerdings auch so von Banksy beabsichtigt oder nicht: in ihren
Dieneruniformen wirken sie wie kostümierte Spielfiguren in einer von
unbekannter Hand geplanten Inszenierung, in der man auch als Gast
eine ganz bestimmte Rolle einnehmen soll. Bei der Aufarbeitung der
berechtigten, wichtigen Thematik lässt einem das allerdings etwas wenig
individuellen Spielraum.
erschienen in: MIXMUC EDITION Juli 2017, Hrsg.: Nachwuchsjournalisten in Bayern e.V. & Kulturraum München e.V.